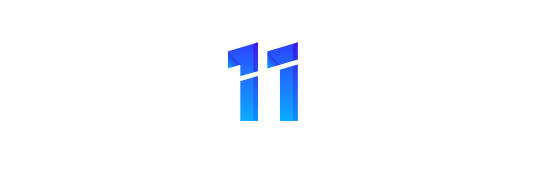Monatelang war in der EU heftig über die Erneuerung des Urheberrechts gestritten worden. Jetzt liegt ein Kompromiss vor. Welche Chancen hat die Einigung – und warum die ganze Aufregung?

Die EU hat sich grundsätzlich auf eine Reform des Urheberrechts verständigt. Damit sollen Google und Co. verpflichtet werden, Inhalte zu entfernen, für die die Urheber keine Lizenz erteilt hatten. Ausgenommen sind Firmen, die seit weniger als drei Jahren bestehen, deren Jahresumsatz weniger als zehn Millionen Euro beträgt und deren Nutzerzahl unter fünf Millionen monatlich liegt.
Warum überhaupt ein neues Urheberrecht?
Die bestehenden rechtlichen Regelungen stammen aus dem Jahr 2001 – das war quasi Internet-Steinzeit. Damals gab es noch keine Video-Plattformen wie YouTube, auf die man auch urheberrechtlich geschützte Inhalte wie das neueste Video der Lieblingsband hochladen kann. Und es gab auch keine großen Suchmaschinen wie Google, die kleine Informationshappen (Snippets) aus Zeitungsartikeln in ihrer Suche präsentieren.
Ist die Reform einvernehmlich?
Nein, im Gegenteil: Der Berichterstatter des EU-Parlaments zu diesem Thema, der deutsche CDU-Politiker Axel Voss (also der, der als Verantwortlicher den Gesetzesentwurf schrieb), sagte, das neue digitale Urheberrecht beende “endlich das Wildwest im Internet, bei dem die Rechteinhaber bisher oft untergebuttert werden”. Dagegen warnte die Europapolitikerin der Piraten-Partei, Julia Reda, die Einigung könne dazu führen, “das Internet, wie wir es kennen, ausschließlich in die Hände der Technologie- und Medienriesen zu legen”. Fünf Millionen Internet-Nutzer unterschrieben eine Petition, die sich gegen die Reform richtet. Während Google, Wikipedia und andere Netzunternehmen vehement gegen das Vorhaben protestierten, sprachen sich zahlreiche Medienhäuser dafür aus.
Worum geht es in dem Streit?
Umstritten sind vor allem zwei Passagen: Artikel 11 beinhaltet ein europäisches Leistungsschutzrecht. Danach sollen Online-Plattformen Verlage bezahlen, wenn sie etwa Artikel veröffentlichen – und sei es nur in Ausschnitten (sogenannte Snippets). Artikel 13 sieht eine urheberrechtliche Haftung des Plattform-Betreibers für dessen Inhalte vor – und zwar ab dem Moment des Uploads. Um das wirkungsvoll zu verhindern, müssen sogenannte Upload-Filter eingesetzt werden, die eben dieses Hochladen technisch verhindern.
Wer profitiert vom neuen Urheberrecht?
Ganz klar die großen Verlagshäuser: Vor allem die hatten das neue Leistungsschutzrecht eingefordert. Ihr Argument: Plattformen wir Google News verdienen Geld mit der geistigen Leistung, die Mitarbeiter dieser Verlage erbracht haben, ohne diese an dem Erlös zu beteiligen. Viele kleine Verlage und Nachrichtenseiten sehen das aber anders: Sie argumentieren, dass sie ohne Suchmaschinen eine viel kleinere Reichweite hätten, dass sie also von ihnen profitierten. Kritiker des neuen Rechts verweisen auf die rechtliche Regelung in Deutschland: Hier gibt es schon seit 2013 ein Leistungsschutzrecht – aber es führte bislang nicht zu nennenswerten Geldzahlungen an die Verlage.
Was hat es mit diesen Upload-Filtern auf sich?
Mit Upload-Filter bezeichnet man Computerprogramme, die beim Hochladen prüfen, ob Bilder, Videos oder Musik urheberrechtlich geschützt sind. Sie sollen verhindern, dass solche Inhalte überhaupt auf Plattformen wie YouTube hochgeladen werden können. Kritiker haben hier mehrere Einwände. Zum einen könnten solche technischen Filter nicht erkennen, ob etwas eine Parodie, ein Meme oder auch nur ein Zitat ist. Zum anderen könnten sich nur große Unternehmen solche Filter leisten, kleineren Unternehmen wäre der Zugang zum Netz versperrt. Und drittens sehen viele in solchen Filtern die Vorstufe zu umfangreicher Zensur. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) teilte diese Bedenken 2012 in einem Urteil. Und auch die Bundesregierung sprach sich in ihrem Koalitionsvertrag ausdrücklich gegen Upload-Filter aus.
Wird dieser Entwurf jetzt umgesetzt?
Nein.Endgültig beschlossen ist das Gesetzespaket noch nicht: Sowohl das Europaparlament als auch sämtliche EU-Staaten müssen noch zustimmen. Und im Parlament gibt es erhebliche Vorbehalte vor allem gegen Artikel 13. Deswegen könnte die Reform noch scheitern. Stimmen beide Seiten zu, haben die EU-Staaten zwei Jahre Zeit, die neuen Regeln in nationales Recht umzuwandeln.