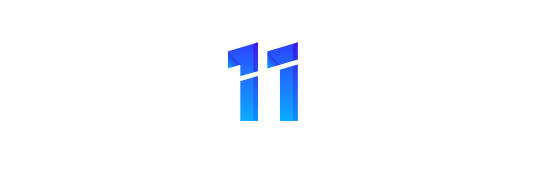Tausende Männer und Frauen aus Honduras haben sich zu Fuß auf den Weg in die USA gemacht. Sie fliehen vor der Armut und Gewalt in ihrer Heimat, auf der Suche nach einem menschenwürdigen Leben.

Am Donnerstagmittag hat sich die Lage in der Casa del Migrante, einer Herberge für Migranten am Rande des historischen Zentrums von Guatemala-Stadt, ein wenig entspannt. Helferinnen und Helfer sortieren Kleidung und Nahrungsmittel in dem dreistöckigen Gebäude, einige müde Menschen ruhen sich auf improvisierten Betten in der Turnhalle der Einrichtung aus. Doch die Karawane ist längst weitergezogen. Noch am Abend zuvor hatten mehrere tausend Menschen Unterschlupf in der Migranten-Herberge gesucht, die eigentlich für nur 70 Personen ausgelegt ist. Mit Hilfe einer nahe gelegenen katholischen Schule, die ihre Türen öffnete, war es gelungen, allen eine sichere Unterkunft für die Nacht zu bieten. Schon in den frühen Morgenstunden des Donnerstags hat sich die Karawane wieder in Bewegung gesetzt. Ihr nächstes Ziel: Mexiko.
Mario ist einer der wenigen, die noch in der Casa del Migrante geblieben sind. Erst in der Morgendämmerung hat er die Herberge erreicht, nun wartet er hier auf seine Schwester, die sich ebenfalls auf den Weg in die USA gemacht hat. “Ich wollte es schon vorher versuchen, aber das Geld hat nie gereicht”, erzählt Mario. “Jetzt, zusammen mit so vielen anderen Menschen, ist es viel einfacher.” Mehr als 300 Kilometer ist er in den vergangenen Tagen zu Fuß gelaufen. “Wir wollen nicht wieder zurück”, sagt Mario. “Zu Hause sterben wir entweder an der Armut oder werden von den Jugendgangs umgebracht.”

Die Migranten-Herberge “Casa del Migrante” in Guatemala-Stadt, Zwischenstation auf dem Weg nach Norden
Zurückgelassen hat der 41jährige seine Frau und seine drei Kinder. “Das ist sehr hart, aber es gibt für mich keine andere Möglichkeit, als Honduras zu verlassen”. 3000 Lempiras (ca. 100 Euro) hat er mit seiner Arbeit als Klempner im Monat verdient – auch in Honduras viel zu wenig, um seine Familie durchzubringen. Hinzu kommt die ständige Angst vor den “Pandillas” – den Jugendgangs, die ganze Stadtviertel terrorisieren. “Wenn ein Mädchen zehn oder elf Jahre alt ist, dann wollen sie schon, dass es zu den Pandillas gehört”, erzählt Mario. “Wer nicht mitmacht, wird ermordet.” Einen Sohn hat er so schon verloren. “Das ist die Angst, die ich immer mit mir herumtrage”, sagt er. “Und deshalb will ich auch meine Familie da rausholen, sie soll endlich in Sicherheit sein.”
Freizügigkeit – und eine Drohung von Donald Trump
Zehn Stunden hat er an der Grenze zwischen seiner Heimat und Guatemala ausgeharrt, bevor die guatemaltekischen Behörden den Weg endlich freigaben. Nun hofft er, dass auch Mexiko seine Grenze für die Karawane öffnet. Auf dem Weg haben die Migrantinnen und Migranten viel Solidarität erfahren. “Die Menschen haben uns zu trinken und zu essen gegeben, einige wurden sogar mit Bussen gefahren”, sagt Mario.

Jedes Transportmittel ist recht: Migranten aus Honduras auf dem Weg durch Guatemala
Auch der Direktor der Migranten-Herberge in Guatemala-Stadt lobt die Hilfsbereitschaft der Menschen in Guatemala: “Sie kennen die schwierigen Zeiten noch aus dem Bürgerkrieg und sind Solidarität gewohnt”, sagt Mauro Verzeletti. Die Entscheidung der guatemaltekischen Regierung, die Migranten nicht aufzuhalten, begrüßt er: “Es ist ein wichtiger Schritt, dass sie nicht kriminalisiert werden”. Seit 2006 besteht zwischen Honduras, El Salvador, Guatemala und Nicaragua ein gegenseitiges Abkommen, dass den Menschen in der Region Freizügigkeit gewährt.
Doch die großen Schwierigkeiten stehen Mario und den anderen Honduranerinnen und Honduranern, die sich der Karawane angeschlossen haben, erst noch bevor: US-Präsident Trump hat bereits angekündigt, im Notfall das Militär zu schicken, um die Migranten von der Einreise in die USA abzuhalten. “Donald Trump sollte sich daran erinnern, dass auch er ein Mensch ist”, sagt Mario. “Er, der schon alles hat, sollte auch anderen Menschen eine Chance geben, in menschenwürdigen Verhältnissen zu leben.”