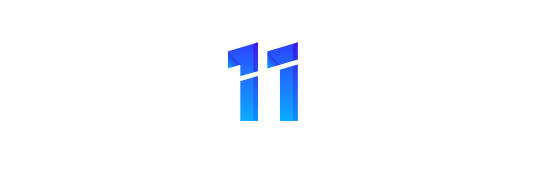Heimat hatte lange eine Bedeutungs-Patina – etwa so wie Vaterland: Irgendwie von gestern, etwas altmodisch, jedenfalls für manche Deutsche. Migranten sehen das anders. Denn sie haben zwei Heimaten.

Heimat – kein Ort, sondern Zeit
Heimat ist für mich die Kindheit, die Wärme der Familie, meine Straße von damals mit den unterschiedlichen Gerüchen, das Licht, der Geschmack der Pflaumen im Hinterhof.
Man sagt: Heimat ist dort, wo meine Familie ist. Heimat ist dort, wo die Freunde sind. Heimat ist dort, wo man zuhause ist und sich wohl fühlt. Aber meine erweiterte Familie lebt in fünf Ländern, meine engsten Freunde sind überall auf der Welt. Und ich bin zuhause in vier Städten und in drei Ländern.
Da ist die Sache mit dem Pass. Überspitzt formuliert ist der Pass ein Führerschein der gehobenen Klasse. Mit dem Pass übernimmt man gewisse Verpflichtungen gegenüber einem Staat und bekommt im Gegenzug gewisse Sicherheiten. Mit der Identität hat das wenig zu tun, eher mit Loyalität, mit Rechtsstaatlichkeit und Gesetzestreue.
Der Papst hat drei Pässe: einen argentinischen, italienischen und einen des Vatikan. Wie widerspiegelt diese Tatsache seine Identität? Ist er Argentinier, Italiener oder Bürger des Vatikan? Oder ist er eher das Oberhaupt der katholischen Kirche?

Alexander Andreev, DW-Bulgarisch
Heutzutage, in einer komplexen und globalisierten Welt, hat man zwangsläufig mehrere Identitäten. Ich bin zum Beispiel von Geburt aus Bulgare, vom Pass her Deutscher. Ich empfinde mich aber stark identisch mit meinem journalistischen Beruf. Eine weitere Identität, die sehr wichtig ist, hängt mit meiner Familie zusammen – und die Mitglieder dieser Familie leben in vier unterschiedlichen Ländern. Weitere Sub-Identitäten, die für mich wichtig sind: Ich bin literarischer Übersetzer und Schriftsteller, Fahrradfahrer, Raucher, Klassik-Liebhaber.
In Deutschland habe ich nie Alltagsrassismus erlebt. Vielleicht liegt das daran, dass mein Aussehen durchschnittlich ist und dass ich die Sprache beherrsche. Als ich aber vor mehr als 27 Jahren als Redakteur bei der Deutschen Welle anfing, waren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem ausländischen Hintergrund grundsätzlich nicht als Journalisten, sondern eher als Übersetzer angesehen. Und jahrelang gab es auf der Ebene der Abteilungsleiter keinen einzigen Kollegen mit einem “Migrationshintergrund”. Das hat sich, Gott sei Dank, geändert.
“Heimat ist da, wo man sich nicht erklären muss”
Dieser Spruch Herders hing jahrelang in unserer Gartenlaube in meiner Geburtsstadt Hermannstadt/Sibiu. Ein mittelalterliches Städtchen in Siebenbürgen, einer mitteleuropäischen Multikulti-Region, die seit 100 Jahren zu Rumänien gehört und vorher rund 1000 Jahre Teil des Königreichs Ungarn war.
Und erklären mussten wir uns dort beileibe nicht. Weder Mihai, der rumänische Nachbarsjunge, noch die ungarischen Zwillingsschwestern Emese und Enikö, noch Anita, ein siebenbürgisch-sächsisches Mädchen oder Matthias, ein deutsch-ungarisch-jüdischer Bub in meinem Alter. Wir wohnten alle in derselben Straße, spielten zusammen, wir rauften und vertrugen uns wieder, wir feierten unsere Feste in den Familien, jedes Fest zu seiner Zeit – und wir feierten oft zusammen. Zu Ostern beispielsweise – die evangelischen und orthodoxen Ostern fielen meistens nicht auf den gleichen Sonntag – gab es deshalb zweimal gefärbte Eier und Lammbraten mit Kartoffelsalat (bei den evangelischen Deutschen) oder mit Mamaliga, dem köstlichen Maisbrei (bei den orthodoxen Rumänen). Bei unseren ungarischen Nachbarn standen die feinen Mehlspeisen nach Budapester Rezept auf dem Tisch. Und bei Matthias gab es zu Pessach Matzen.

Robert Schwartz, DW-Rumänisch
Und später, als wir größer wurden, den süßlichen Carmel-Wein. Der fast so süß war wie der Bananenlikör, den uns Emmi-Tante heimlich anbot, wenn wir sie am Ostermontag mit unserem billigen Parfüm aus einem kleinen Fläschchen “bespritzten” – ein alter Brauch, bei dem die Buben alle Mädchen und Frauen in der Nachbarschaft behutsam mit Duftwässerchen beträufelten. Sparsam, damit es auch für alle reichte. Und keiner fragte, ob man als Christ Matzen essen durfte oder als Jude Ostereier. Wir aßen alles und es war schön so. Wir lebten in Parallelwelten, jeder in seiner Familie und seiner Sprache und Identität – und doch immer wieder miteinander. “Die einzigen Parallelen, die sich überschneiden – das sind wir hier in Hermannstadt”, pflegte mein Vater zu sagen.
Das war Heimat für mich. Eine Scheinwelt, die unsere Eltern für uns nach den Gräueln des Zweiten Weltkriegs errichtet hatten? Eine Insel der Glückseligkeit, weit weg von der schmerzhaften Wirklichkeit der kommunistischen Diktatur, in der wir lebten? War es mein Macondo? Mein Yoknapatawpha? Vielleicht. Und dennoch – ich will die Zeit nicht missen und die Freunde von damals, die auch heute meine Freunde geblieben sind. Heimat, die ich in meiner Seele mit mir trage, nicht als Bürde, sondern als Quelle der Inspiration für neue Heimaten, die ich in den Jahrzehnten seither erobert oder die mich erobert haben. Und die mir durchaus erlauben, auch in Deutschland sagen zu können: Heimat, hier bin ich. Ohne mich weiter erklären zu müssen.
Der familiäre Geschmack gemeinsamer Traditionen
Im sogenannten Alten Europa, alias EU, kommt der veraltete Begriff “Heimat” etwas ermattet daher. Gott sei Dank, denn früher sind im Namen der jeweiligen Heimat Kriege auf unserem Kontinent geführt worden. Heute fühlt man sich zuhause genauso in Athen, in Köln oder in Porto. Überall der familiäre Geschmack gemeinsamer Traditionen.
Ich habe als Europäer einen griechischen Hintergrund und eine deutsche Patina. Ist doch wunderbar. Grieche in der Alltagskultur, Deutscher im Berufsleben. Man pickt sich halt das Beste raus da, wo man es findet. Das ist keine Beliebigkeit, sondern Neuorganisation der Lebensordnung in einem größeren Rahmen.
Vorteile habe ich auch mit der doppelten Staatsangehörigkeit. Irgendwie schaffen es die Griechen immer, Ausnahmeregelungen für sich zu beanspruchen. Infolgedessen habe ich zwei Pässe. In Tunesien zeige ich meinen griechischen Pass, dann ziehen mich die Händler nicht über den Tisch, kleine, arme Völker gehen miteinander solidarisch um. Bin ich in der Türkei, zeige ich lieber meinen deutschen Pass, damit mein Gegenüber nicht auf dumme Gedanken kommt. Bin ich opportunistisch veranlagt? Nein, ich glaube, ich habe mich gut in zwei Staatsangehörigkeiten eingerichtet.

Spiros Moskovou, DW-Griechisch
Und dann die Identitätsfrage. Wer bin ich? Grieche oder Deutscher, Christ oder Atheist? Mein Personalausweis mit seinen knappen Begriffen scheint es genau zu wissen. Die Identität ist aber für mich kein Zaun, in dem man sich sicher fühlt, sondern das Ergebnis eines Lebensweges, der zwischen einer Herkunft und einem Zielort verläuft. In der Zwischenzeit verliert die Abstammung an Grelle und der Zielort an Ausstrahlungskraft. Letztendlich ergibt sich meine Identität aus dem, was ich getan und gelassen habe. Aber wer will das schon so genau wissen?
Am Ende zählt die Erfahrung. Mal denken meine deutschen Mitbürger, ich sei wegen der Aussprache Holländer, mal wegen der schwarzen Haare Korse, mal wegen meiner Vorliebe für Grappa Italiener. Ist nicht schlimm. Hauptsache sie geben mir nicht das Gefühl, ich sei in diesem Land benachteiligt oder diskriminiert. Und das machen sie buchstäblich seit fünfunddreißig Jahren nicht.
Meine Sternstunde kam aber mit der Griechenlandkrise um 2010. Da war ich plötzlich in der ganzen Nachbarschaft zu einem wahren Objekt der Neugierde geworden. Ich wurde auf der Straße angesprochen, beim Bäcker aufgehalten, sogar von sonst so distinguierten Nachbarn zum Essen eingeladen. Alle wollten von mir nur das Eine: die Lösung des griechischen Rätsels, eine gültige Erklärung für die Krise. Dabei habe ich bis heute nicht mal für mich selbst dieses Rätsel endgültig gelöst.