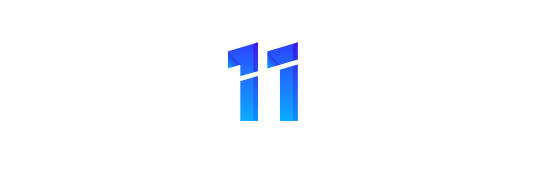Das Champions-League-Finale in Kiew verdeutlicht, wie sehr auch der Fußball unter dem Krieg in der Ost-Ukraine leidet. Viele Ultras sind ins Visier der prorussischen Separatisten geraten – aufgeben wollen sie nicht.

In der Fankurve, umgeben von Freunden, hinter wehenden Fahnen mit dem Vereinslogo – so fühlt sich Igor Kovtun wohl. Doch die Fankurve musste dem Krieg weichen. Sein Verein Sorja Luhansk floh aus dem Osten der Ukraine. Prorussische Separatisten hatten seine Heimatstadt zu einer „Volksrepublik” erklärt. Sorja bestreitet seine Heimspiele nun in der Fremde, im südlichen Saporischschja oder im 1300 Kilometer entfernten Lwiw.
Viele proeuropäische Fans haben die Industriestadt Luhansk verlassen, sie waren von prorussischen Truppen bedroht und attackiert worden. „Mein Verein wurde für mich noch wichtiger, weil er ein starkes Symbol für unsere Stadt ist”, sagt IT-Entwickler Kovtun, der nun im zentralukrainischen Poltawa lebt. „Über den Fußball können wir uns mit Luhansk identifizieren, das stärkt das Gemeinschaftsgefühl und den Durchhaltewillen unserer Gruppe.”
Dutzende Sticker in der Waffenkammer

In Kiew sind die Vorbereitungen für das Finale zwischen Real und Liverpool getroffen
Am Samstag treffen Real Madrid und der FC Liverpool im Finale der Champions League aufeinander. Der Schauplatz: Kiew. Im Osten der Ukraine sind nach UN-Angaben bereits über 10.000 Menschen getötet worden. Zwei Millionen Menschen sind geflohen, innerhalb ihrer Heimat, aber auch nach Polen und Weißrussland. Drei Wochen vor der WM in Russland lenkt nun das Endspiel des wichtigsten Klubwettbewerbs die Aufmerksamkeit auf eine Krise, über die in Westeuropa nicht mehr allzu viel berichtet wird.
Dabei gehören Schicksale wie jene von Igor Kovtun zum Alltag. 2014, im Alter von 23 Jahren, hatte er Luhansk verlassen, kurz nach der Annektierung der Krim. Wie andere Ultras schloss er sich der ukrainischen Armee an, in den Waffenkammern sah er dutzende Sticker von Fußballsklubs. Die Fankultur sei eine Plattform für Patriotismus sagt Kovtun, selbst rechte Fans würden ihre Haltung überdenken: „Viele Ultras haben eingesehen, dass nicht Menschen mit anderer Hautfarbe für ihre Probleme verantwortlich sind, sondern dass diese durch Korruption und Machtmissbrauch verursacht wurden.”
Auf Einladung des Fußballkulturvereins „Gesellschaftsspiele” erzählte Kovtun bei einer Veranstaltung in Berlin auch von einer gewissen Aufbruchsstimmung: „Viele junge Leute sind zu Hause ausgezogen und haben eigene Geschäftsideen entwickelt. Das ist ein pragmatischer Weg.”
Einstige Rivalen gehen aufeinander zu
Eine Zäsur für die Ukraine war der “Euromaidan” ab November 2013. An den Bürgerprotesten gegen den damaligen prorussischen Präsidenten Wiktor Janukowytsch beteiligten sich auch Fußballfans. Rechte Hooligans von Dynamo Kiew und linke Ultras von Arsenal Kiew schützten Demonstranten vor Regierungstruppen, auch in anderen Städten beteiligten sich junge Anhänger. Viele von ihnen leben seitdem gefährlich, weil sie auf „schwarzen Listen” der Separatisten stehen.
Die Fangruppen verzichten seither auf das Ausleben ihrer Rivalität. Sie unterstützen verstärkt das Nationalteam und singen mit Inbrunst die Hymne. „Es ist friedlicher geworden in den Stadien”, sagt der Journalist und Osteuropa-Experte Thomas Dudek. „Gruppen aus unterschiedlichen Städten haben Kontakt miteinander. Als Ultras von Sorja Lugansk im Gefängnis saßen wurde in allen Stadien für ihre Freilassung demonstriert.”
Rechtsextreme Parteien wollen Ultras vereinnahmen
Seit dem Krieg in der Ost-Ukraine ist der Zuschauerschnitt in den Stadien gesunken. Die oberste Spielklasse musste verkleinert werden, ein erfolgreicher Verein wie Metalist Charkiw verschwand von der Bildfläche. Der Klubbesitzer hatte sich wegen Korruptionsvorwürfen nach Russland abgesetzt. Charkiw ist nun Exilspielstätte von Schachtar Donezk, dem erfolgreichsten Verein der Ost-Ukraine. Auch das moderne Stadion und der Flughafen in Donezk waren beschossen worden.
Etliche Ultras aus Donezk kehren nach und nach aus der ukrainischen Armee zurück. Oft seien sie traumatisiert und radikalisiert, sagt der Osteuropa-Aktivist Ingo Petz: „Mittlerweile versuchen auch rechtsextreme Parteien, die Ultras für sich zu gewinnen. Leider haben die Vereine und der Staat kein Interesse an den jungen Fans. Das ist schade, denn viele Fans wünschen sich eine Demokratisierung.”
Die „Fankurve Ost” stößt einen Ideenaustausch an
In Berlin finden seit 2014 Seminarwochen mit ukrainischen, russischen sowie weißrussischen Fans und Journalisten statt. Verantwortlich dafür ist die „Fankurve Ost”, ein Projekt innerhalb des Berliner Vereins „Deutsch-Russischer Austausch”. Ingo Petz ist einer der Gründer und diskutiert mit den Teilnehmenden über Möglichkeiten der Teilhabe. Die Klubs, die von Staatskonzernen und Oligarchen gelenkt werden, lassen diese selten zu.
In Deutschland sind viele Fangruppen politisch aktiv, durch Proteste, Gedenkstättenfahrten oder Vortragsabende. In Osteuropa ist das so noch undenkbar. „Der Begriff des Politischen ist in vielen Ländern Osteuropas verbrannt”, sagt Ingo Petz. Ob in Russland unter Putin, in Weißrussland unter Lukaschenko und in der Ukraine noch unter Janukowytsch: Die Zivilgesellschaft gilt als Gegenbewegung, nicht als Partnerin des Staates. Und die Regime schauen mit Sorge auf das Mobilisierungskräfte der organisierten Ultras.
Neue Projekte der Prävention
Die „Fankurve Ost” betrachtet den Gestaltungswillen dagegen als Chance. Auch der Verein „Gesellschaftsspiele” etabliert ein Netzwerk zwischen deutschen und ukrainischen Anhängern. „Mit Hilfe des Fußball erreichen wir junge Leute, die noch nicht in den zivilgesellschaftlichen Filterblasen unterwegs sind”, sagt Ingo Petz. So ist jenseits der Verbandshierarchien ein Ideenaustausch entstanden. Ukrainische Teilnehmer der „Fankurve Ost” schreiben Artikel, drehen Filme, entwickeln Projekte: Für die Resozialisierung von jungen Strafgefangenen, für Fan-Kommunikation, für Übernachtungsmöglichkeiten am Wochenende des Champions-League-Finales in Kiew.
Für Igor Kovtun steht das Endspiel nicht im Vordergrund. Als er 2014 seine Heimatstadt Luhansk wegen des Krieges verlassen musste, hoffte er auf eine Rückkehr schon wenige Wochen später. Vier Jahre sind inzwischen vergangen, die Wirtschaftskrise schwelt und die Ultras können sich oft nur jede zweite oder dritte Partie von Sorja leisten. Igor Kovtun träumt jedoch von Heimspielen, die diesen Namen auch verdienen.