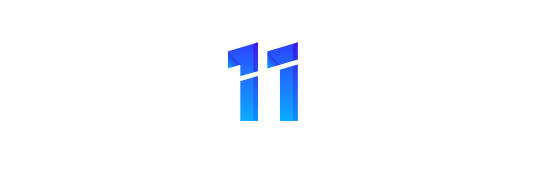Der künstlerische Leiter der “International Telekom Beethoven Competition Bonn” erklärt, was den Musikwettbewerb einzigartig macht. Los geht es damit, dass er muskalischen Konkurrenzkampf nicht mag.

Der russischstämmige, in der Ukraine geborene Pianist hat an vielen Wettbewerben teilgenommen und war der jüngste Professor für Klavier am St. Petersburger Konservatorium. Nach seinem Umzug nach Deutschland 1978 trat er mit mehreren europäischen Orchestern auf und wurde auch durch Soloauftritte und Schallplatten- und CD-Aufnahmen bekannt. Im Bereich Kammermusik spielte er unter anderem im renommierten Duo mit dem inzwischen verstorbenen Cellisten Boris Bergamentschikow und gründete das “Gililov Piano Quartett”. Seit 2003 ist Pavel Gililov deutscher Staatsbürger. Der Professor an der Kölner Musikhochschule gründete 2005 die Internationale “Telekom Beethoven Competition Bonn” (ITBCB) und ist künstlerischer Leiter und Juryvorsitzender des Klavierwettbewerbs.
Deutsche Welle: Der ITBCB geht dieses Jahr in die siebte Auflage. Wie sehen Sie den Wettbewerb heute, wenn Sie sich an die Anfänge vor 12 Jahren erinnern?
Pavel Gililov: Wir haben viele Erfahrungen gemacht und neue Aspekte hinzugefügt. Dadurch ist der Wettbewerb reifer, runder und ausgereifter geworden.
Welche Stellung hat dieser Wettbewerb in internationalen Vergleich?
Er unterscheidet sich von anderen, weil wir programmatische Inhalte haben, die zum Gesamtkonzept gehören. Bei uns ist natürlich der Namensgeber Beethoven immer im Mittelpunkt – aber im Zusammenhang mit verschiedenen Musikepochen.
Sie waren sowohl als Teilnehmer als auch als Juror an vielen Wettbewerben beteiligt. Was gefällt Ihnen an einem Wettkampf in der Kunst so gut, dass sie einen eigenen initiiert haben?
Ich mag den Begriff Wettbewerb als Konkurrenz- oder Gladiatorenkampf im engeren Sinne nicht, aber ich merke immer wieder, dass dadurch fantastische Kontakte und ein Austausch durch junge Leute zustande kommen. Man gibt ihnen eine Möglichkeit, auch vor einem großen Publikum aufzutreten und immer ein Feedback von der Jury zu bekommen, sodass sie wissen, was gut war und was besser werden kann. Und für das Publikum hat ein Wettbewerb etwas Romantisches an sich, weil es mit Neuentdeckungen zu tun hat.
Wäre dann nicht ein “Nachwuchskünstlerfestival” genauso wirksam, das keinen Wettkampfcharakter hat?

Im Austausch mit der Jurorin Lilya Zilberstein
Ich tue alles dafür, um den Wettkampfcharakter zu vermeiden. Erstmal räumen wir dem Publikum immer mehr Möglichkeiten ein, aktiv teilzunehmen und die Auftritte zu bewerten. Im Vergleich zu anderen Wettbewerben ist die ganze Atmosphäre hier doch sehr freundlich und sehr weit vom Prüfungscharakter weg. Ich sehe unseren Wettbewerb als ein internationales Klavierfestival. Es geht um tiefsinniges Spielen, Kommunikation mit dem Publikum und ernsthafte Interpretation.
Das zeigt sich meines Erachtens auch bei den langen Spielzeiten der Teilnehmer. Wie bleibt man als Juror bei einer solch großen Menge an Musik noch sensibel für den besonderen Moment?
Ein Jury-Mitglied muss immer sensibel bleiben. Wir haben im Programm so hochkarätige Musik, dass es nie ermüdend und langweilig wird. Die Idee, gleich in der ersten Runde anspruchsvollste Werke im Programm zu haben, fand ich sehr gelungen. Jemand, der eine der drei letzten Sonaten von Beethoven wirklich gut spielen kann, ist ein ernstzunehmender Künstler. Man weiß: Wer in die zweite Runde kommt wird nicht enttäuschen.
Sie haben in Interviews betont, dass Beethoven und Schumann zu den wichtigsten Komponisten für Sie persönlich gehören. Was macht diese beiden so einzigartig?
Beide haben eine sehr persönliche Klangsprache. Das soll nicht heißen, dass etwa Brahms keine persönliche Sprache hat. Aber in jeder seiner Sonaten präsentiert Beethoven etwas Neues, es werden immer interessante Probleme und Ereignisse dargestellt. Und bei ihm hat jeder Ton eine Bedeutung – was man nicht von allen Komponisten behaupten kann. Bei Beethoven merkt man sofort, wenn eine Note nicht im Konzept steht. Dann leidet die ganze musikalische Struktur sehr.
Und was Schumann betrifft: Seine Ideen sind originell und weichen vom Routinedenken ab. Wer Zugang zu diesem Komponisten bekommt, besitzt meiner Meinung nach große Sensibilität, Musikalität und psychologisches Talent. Das Wichtigste bei Schumann ist, seine Sprache zu verstehen, weil seine Phrasenbildung sehr ungewöhnlich ist. Zum Beispiel muss man bei seinen vielen rhythmischen Verschiebungen erkennen, ob es eine Synkope oder ein ausgeschriebenes Rubato ist. Das setzt wirklich große musikalische Erfahrung voraus. Schumann und Janáček sind zwei Komponisten, die vom Mainstream abweichen.

Über seinen Kopf hinweg wird keiner Sieger. Hier: Daiki Kato aus Japan
Wie schwierig war die Vorauswahl der Teilnehmer aus den vielen Einsendungen dieses Jahr?
Eine Auswahl ist immer sehr schwierig. Man trägt die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass den Zuhörern schon in der ersten Runde ein sehr hohes Niveau geboten wird. Deshalb ist von Anfang an der Saal ziemlich voll. Viele Kollegen von anderen Wettbewerben sagen mir: “Das ist unglaublich, dass bei Euch in Bonn von Anfang so viele Zuhörer dabei sind!” Das liegt natürlich auch an der Programmauswahl, weil die fast wichtigsten Werke von Beethoven bereits in der ersten Runde zu hören sind.
In Bonn gibt es ein sehr gebildetes Publikum. Die Leute kennen nicht nur die Stücke, sondern auch verschiedene Interpretationen – und das sind keine Einzelfälle. Sie genießen den Wettbewerb und kommen zahlreich. auch weil sie wissen, dass sie eine engagierte Aufführung mit persönlichem Anteil erwarten können. Bei uns muss man texttreu spielen, aber auch mit Herz.