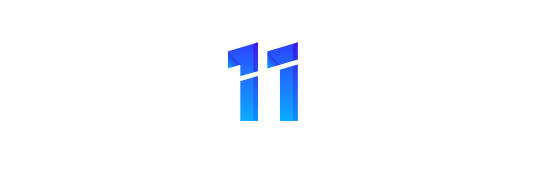Einwanderung
“Irgendwie ist diese Flucht nie vorbei”
Der Umgang mit illegalen Einwanderern aus Mexiko ist eines der großen Reizthemen in diesem US-Wahlkampf. Ines Pohl hat sich in Texas bei Flüchtlingen wie Grenzschützern umgehört.

Greifvögel zirkeln über die Felder. Elegant und kraftvoll. Jederzeit bereit zur tödlichen Attacke. McAllen ist ein Paradies für Ornithologen. Besonders jetzt im Frühjahr. An heißen Sommertagen steigen die Temperaturen auf über 40 Grad im Schatten. “Dann ist niemand draußen, der es irgendwie vermeiden kann”, sagt Jose Cruz. Er ist hier geboren, kennt fast jede Wendung des Rio Grande, der natürlichen Grenze zwischen Texas und Mexiko. Dem Fluß, der nicht nur Staaten, sondern Welten trennt.
Illegale Einwanderung ist eines der Top-Themen dieses Wahlkampfes. 3144 Kilometer lang ist die Grenze zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten. Die Mauer, die Donald Trump errichten will, um illegale Einwanderung zu stoppen, fehlt in keiner politischen Debatte in diesem Wahljahr.
Cruz hat viele Jahre im Ausland gearbeitet, für die Vereinten Nationen Grenzen bewacht und Kontrollen organisiert, im Kosovo und in Mazedonien. Jetzt ist er wieder zu Hause, um seine eigenen Leute zu beschützen.

Patroullieren die texanisch-mexikanische Grenze im Privat-Auftrag: Jose Cruz und sein Kollege Jerry Brumley
“Die Vereinigten Staaten sind von Einwanderern gegründet worden. Ich bin nicht gegen Einwanderung”, sagt Cruz. “Aber wir müssen Wege finden, kontrollieren zu können, wer in unser Land kommt.”
Zu wenig Personal und veraltete Technik
“Die offizielle Grenzkontrolle kann das nicht leisten”, meint er. Sie sei unterbesetzt und mit völlig veralteter Technik ausgestattet. Deshalb arbeitet er seit drei Jahren für die private Organisation ISA (International Security Agency) in McAllen. “Wir überwachen die Gebiete, für die wir verantwortlich sind, komplett mit Foto- und Infrarot-Technik. Die arbeitet vollautomatisch und sendet Signale aus, wenn sich etwas bewegt.”
Die Hauptauftraggeber der Firma sind derzeit Farmer, die ihre Ländereien im Grenzgebiet haben. Schutz brauchen sie vor allem gegen Drogenkartelle und Menschenschmuggler, die nicht nur verbal drohen, wenn sie bei ihren Geschäften gestört werde. Eigentlich wollen Cruz und seine Kollegen für den Staat arbeiten. “Wir bekommen viel Unterstützung für unsere Ideen, aber kein Geld.” Politiker wollten nicht in sinnvolle Technik investieren, sondern in etwas, das man sieht. “Wie diese riesige Mauer.”
Auch wenn er Trump grundsätzlich unterstützt, hält er wenig von dessen Plänen. “Alles, was die illegale Einwanderung verringert, ist gut. Aber das stoppt sie nicht. Was wir brauchen ist ein digitaler Zaun. Wir brauchen eine lückenlose Bodenüberwachung.”

Cruz hat keine Angst vor den
Einwanderern aus Mexiko und Lateinamerika. “Wenn sie vor Gewalt oder Krieg fliehen ist es in Ordnung, wenn sie hier bleiben.” Seine größte Sorge ist, dass radikale Islamisten über die schlecht gesicherte Grenze in die Vereinigten Staaten kommen. “Das sind die wirklich gefährlichen Leute. Und die würden sich niemals von einem Zaun aufhalten lassen.”
Tödlicher Streifen Niemandsland
Mit einem bis dato unerreichten finanziellen Aufwand wurde in den vergangenen Jahrzehnten ein Grenzzaun aus Eisenstreben errichtet. Rostrot ragen sie in den Himmel, zwischen zwei und sechs Metern hoch. Oben sind kleine Überwachungskameras angebracht. “Die musst die Flüchtenden frühzeitig entdecken. Wenn sie erst am Zaun sind, ist es zu spät.” Deshalb brauche man eine Überwachung, die die Flüchtlinge im 20 Meilen breiten Niemandsland aufspüre, diesem vor allem im Sommer oft tödlichen Streifen, der zwischen der Mexikanischen Grenze und den Sicherungsanlagen der Vereinigten Staaten liegt.
Video ansehen
00:35
#WhatAmerica: Jose Cruz
Tiefblau spiegelt sich der Himmel im Rio Grande. Grenzschützer Jose Cruz blickt auf eines seiner Handys. Wenig später liest er den Bericht eines lokalen Nachrichtensenders vor: Ganz in der Nähe gab es eine Schießerei, verletzt wurde niemand. Immer wieder werden Schüsse von der mexikanischen Grenze in Richtung USA abgefeuert. “Das sind keine normalen Immigranten, das sind die Kartelle. Sie versuchen, die Grenzpatrouillen einzuschüchtern und freies Feld für ihre Operationen zu bekommen.”
Der Vater wird immer gewalttätiger
Diego Mancha ist sieben, als seine Mutter ihn und seine kleine Schwester in den Schwimmunterricht steckt. Die Situation zu Hause wird immer unerträglicher. Mittlerweile beginnt der Vater schon am Donnerstag zu trinken, oft bis spät in den Sonntagabend. Erst schlägt er die Mutter, dann auch die beiden Kinder. “Zuhause” ist das väterliche Elternhaus mit Großeltern und Tanten in Mexico City.
Dass die Mutter versuchte, ein Besuchervisum für die USA zu bekommen, hat er damals nicht verstanden. Im Juni 2002 steht die Mutter plötzlich mit zwei Koffern vor der Schule. Zum ersten Mal in seinem Leben steigt Diego in ein Flugzeug. Nach Monterrey. Von dort geht es weiter mit dem Bus in den kleinen Grenzort Piedras Negras, rund 400 Kilometer nördlich von McAllen. Es wird lange dauern, bis er wieder fliegen wird.

Kein unüberwindbares Hindernis: der US-Grenzzaun zu Mexiko
Die Großmutter mütterlicherseits und die Tante leben schon seit einiger Zeit in den USA. Sie haben ein Visum und können die Grenze überqueren. “Wir trafen sie. Ich verstand nicht, weshalb meine Mutter ihnen unsere beiden Koffer mitgab. Nur einen Satz trockene Kleider für jeden von uns behielt sie. Ich erinnere mich noch gut an diese letzte, lange Umarmung meiner Großmutter.”
Trockene Kleider in einer Plastiktüte
Sie verstecken sich in einem kleinen verlassenen Haus im Grenzgebiet mit zwei anderen Frauen und einigen Kindern. Es ist ein Samstag. Die Mutter streitet mit fremden Männern. Viele Jahre später erklärt sie Diego, dass sie für gefälschte Papiere bezahlt hatte. Hier will niemand mehr etwas davon wissen. Ein Mann kommt. Schärft ihnen ein, sich auf der anderen Seite des Flusses sofort umzuziehen und die nassen Kleider liegen zu lassen. Dann geht alles schnell. Er drängt sie ins Wasser. Diego Mancha, seine Schwester und Mutter klammern sich verzweifelt an den schwarzen Reifen, der auf dem grauen Wasser liegt. Der Mann schwimmt vorneweg, Mancha kann sich nicht erinnern, wie lange sie im Wasser sind. Der Unbekannte wirft die Plastiktüte mit den Kleidern ans andere Ufer, wartet, bis sie an Land sind. Dann ist er weg.
“Ich habe nicht darauf geachtet, wohin er verschwand. Ich war so beeindruckt von ein paar weißen Leuten, die Fußball spielten, nur wenige Meter von der Grenze entfernt. Als würde die gar nicht existieren.” Bis heute erinnert er sich an all die vielen nassen Kleider, die überall herumlagen. “Ich wünsche, ich hätte damals mein Handy gehabt, um ein Foto zu machen. Es war alles so … skurril.”
Wenig später sitzen sie in einem Auto. Eine Frau fährt, die Mutter sitzt vorne, Diego Mancha und seine Schwester müssen sich auf den Rücksitz legen, so dass sie von außen niemand sieht.
Sie schaffen es, ohne kontrolliert zu werden nach San Antonio, zur Familie. “Meine Mutter ist sehr religiös. Sie betet die ganze Zeit zur Heiligen Maria von Guadalupe. Vielleicht war es nur pures Glück. Vielleicht half sie wirklich.” Für einen Moment weicht sein verschmitzes Lachen einer Ernsthaftigkeit die ahnen lässt, was dieser 22-Jährige, der so jungenhaft daherkommt, erlebt hat.

Brutale Zustände in den Lagern
Flüchtlinge, die geschnappt werden, werden in Lager gebracht.Wie Kimberly Rivera, die mit ihren beiden Kindern aus Honduras über Mexico in die USA geflohen ist. Sie erzählt unter Tränen von den unwürdigen Zuständen, mangelhafter Versorgung, brutalen Wärtern. “Wir waren sehr durstig und bekamen nicht genügend zu trinken. Sie haben uns alles weggenommen. All meine privaten Dinge. Meine Kinder mussten im Lager zusehen, wie Menschen sich das Leben nahmen.” Nach der Erfassung beginnt das Warten. Es kann mehrere Jahre dauern, bis ein endgültiges Urteil gefällt wird. Die 27-Jährige hat große Angst, dass sie vielleicht zurück muss nach Honduras, gefoltert wird oder ermordet, wie so viele ihrer Freunde und Familienangehörigen.
Diego Mancha und seine Familie schaffen es unbehelligt bis zu Tante und Großmutter, die in einem relativ wohlhabenden Vorort von San Antonio leben. Viele Weiße, kaum Latinos. Die Tante besitzt ein recht erfolgreiches Reinigungsunternehmen.
Mancha kommt in eine zweisprachige Grundschule. Er ist klein und drahtig. Man sieht, dass er ein guter Läufer ist. Beim Laufen verletzt man sich nicht so schnell wie bei anderen Sportarten. Die Mutter hat ihm früh eingebläut, aufzupassen. Die Familie hat keine Krankenversicherung.
Er muss schwören, es niemandem zu erzählen
Es dauert einige Jahre bis er merkt, dass ihn etwas ganz Grundsätzliches von seinen Mitschülern unterscheidet. Am Anfang denkt er, es sei einfach das Geld, das fehlt. Und dass er deshalb bei den Schulausflügen nicht dabei sein kann. Irgendwann nimmt ihn seine Mutter zur Seite, lässt ihn auf die Heilige Maria de Guadalupe schwören, dass er niemandem jemals erzählen wird, dass er keine Papiere hat. Dass er, seine Schwester und seine Mutter illegal im Land sind.
Mancha beginnt zu verstehen, dass er anders ist. Dass sein Leben Grenzen hat hier in Amerika.
Video ansehen
00:35
#WhatAmerica: Jose Cruz
Über die Jahre wird es immer schwieriger, seinen Schulfreunden zu erklären, warum er nie mit nach Mexico kommt. Warum er keinen Führerschein macht, keine Jobs annimmt, obwohl die Familie offensichtlich doch zu den ärmsten in der Nachbarschaft gehört.
Diego Mancha ist so gut in der Schule, dass seine Lehrer ihn für einen Kurs zur Vorbereitung aufs College empfehlen. Er besteht. Und soll, wie alle anderen, Anträge ausfüllen für Stipendien. “Aber ich konnte nicht. Ich hatte keinen Status, geschweige denn eine Sozialversicherungsnummer. Ich dachte nur: Jetzt stecke ich richtig in der Scheiße.”
Ohne Papier kein Stipendium
Und wieder ist es der Gedanke an die Mutter, die die Schule abbrechen musste, der ihn nicht aufgeben lässt. “Ich wollte der erste in der Familie mit einem Hochschulabschluss sein.”
Also spricht er endlich mit seiner Betreuerin. Erzählt ihr die Wahrheit. Sie ist schockiert, fragt ihre Kollegen. Niemand hier in diesem weißen Vorort hat Erfahrung mit Schülern ohne Dokumente. “Ich fühlte mich wieder wie ein Außenseiter.”
Es ist das Jahr 2012. Präsident Obama hat den sogenannten Dream Act erlassen, eine Verordnung, die Kindern wie Diego hilft. Auch wenn es keine völlige Legalisierung ist, so kann er dank der neuen Gesetze endlich eine Arbeitsgenehmigung bekommen, seinen Führerschein machen. Ein halbwegs normales Leben führen. Aber zunächst bleibt er vorsichtig. Was, wenn Obama verliert und Matt Romney ins Weiße Haus einzieht. Was passiert dann mit den Daten? Würde er nach all den Jahren vielleicht doch noch deportiert werden? Und seine Schwester und seine Mutter gleich mit? Er wartet ab. “Aber dann geschah irgendetwas in diesem Sommer. Ich konnte es einfach nicht mehr ertragen. Auf einer Pressekonferenz packte ich alles aus.”
Ein riesiger Befreiungsschlag. Die meisten seiner Freunde waren geschockt. Nicht über seine Herkunft, sondern darüber, dass er seine wahre Geschichte so lange vor ihnen verheimlicht hatte.
“Mein coming out hat gab mir so viel Energie. Ich habe mich unglaublich befreit gefühlt.

Schwamm als Kind illegal in die USA: Diego Mancha
Kofferpacken, falls Trump gewinnt
Jetzt, wo Diego Mancha seine Geschichte nicht mehr verheimlicht, kann er sich um Stipendien bewerben. Organisationen wie The Dream.US helfen ihm, seine College-Gebühren zu bezahlen. Dank Obamas Initiative kann er arbeiten, Geld verdienen und seine Mutter entlasten.
Ist er angekommen? Fühlt er sich als Amerikaner? “Mit diesem Bekenntnis habe ich ein Problem. Ich bin dagegen, dass man sich assimilieren muss. Jeder sollte in der Lage sein, seine eigene Kultur zu behalten.”
In zwei Monaten wird Diego seinen College Abschluss machen. Dann zwei Jahre arbeiten, um sich damit den Traum zu erfüllen, auf die Uni zu gehen. “Ich werde der erste in meiner Familie sein, der einen Doktor-Titel haben wird.”

Zweifel dass er es nicht schaffen könnte, hat Diego Mancha keine. Einen Unsicherheitsfaktor aber gibt es. “Ich plane schon was ich machen werde, wenn
Donald Trump zum Präsidenten gewählt wird. Ich überlege nur noch, ob ich nach Mexiko oder Kanada gehen sollte.” Wäre es nicht hart, die USA zu verlassen? “Ich bin hier, wenn sie mich hier wollen. Ich habe noch immer keine Rechte. Irgendwie ist die Flucht nie zu Ende.”