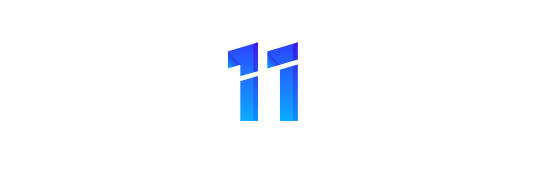Film
Was ist eine Familie? – Das Kino der Berlinale fragt nach
Die Vorstellungen, was eine Familie ist, verändern sich weltweit. Behutsam hier, radikal dort. Das Kino der Berlinale erzählt von den Umbrüchen. Und viele Fragen stellt es auch.

Hier feiern die Männer, dort tanzen die Frauen. Die Braut sitzt abseits. Eine Hochzeit in einem Beduinendorf in der südisraelischen Wüste. Sulimann hat sich eine zweite, eine jüngere Frau genommen. Er hat ihr ein schönes neues Haus gebaut. Jalila bemüht sich um Haltung. Sie ist Sulimanns erste Frau, vier Töchter hat sie ihm geboren. Ihr Haus sieht schäbig aus, der Kühlschrank ist leer, die Waschmaschine kaputt. Und Layla, die älteste Tochter, macht ihr Sorgen. Das aufgeweckte Mädchen hat sich in einen Mitstudenten verliebt. Der Vater wird diese Beziehung nicht dulden, also untersagt die Mutter Layla den weiteren Umgang mit dem jungen Mann. Was folgt in diesem außerordentlichen Regiedebüt (“Sufat Chol”) der israelischen Filmemacherin Elite Zexer, ist der Versuch, überkommene Traditionen zu überwinden. Layla, die Selbstbewusste, versucht es mit Wut und Entschiedenheit, ihre Mutter wählt den stillen Weg. Aber die erstarrten Strukturen sind stark. Es braucht mehr Frauen wie diese beiden, um sie wirklich aufzubrechen. Irgendwann einmal, in der Zukunft.
Stillstand oder Bewegung?
Was machen eingeschriebene Familienkonstruktionen mit Menschen, die eigene Wege gehen wollen? Das fragen Filmemacher überall auf der Welt. Einige ihrer Antworten zeigt das diesjährige Panorama, eine Sektion der Berlinale. “Nakom”, eine amerikanisch-ghanaische Koproduktion, ist das intime Portrait eines Dorfes auf dem Lande und seiner Bewohner, die von der Hand in den Mund und von Ernte zu Ernte leben. Idrissu ist weggegangen, er studiert in Accra Medizin. Aber nach dem plötzlichen Tod des Vaters muss er zurückkommen und Verantwortung übernehmen – für die große Familie, die Felder, die Geschicke des Dorfes. Ein Jahr lang bleibt er, erlebt den Wechsel der Jahreszeiten, die Schönheit der Landschaft, das kleine Glück. Aber er sieht auch die Begrenztheit des Lebens, starre Geschlechterrollen, hierarchische Strukturen und den Stillstand. Am Ende muss er sich entscheiden. Am Ende, ließe sich auch sagen, kann er sich entscheiden. Denn Idrissu ist ein Mann. Er geht zurück zur Universität.

Idrissu – noch in seinem Dorf
Clash der Generationen
Ein anderer Film wirft den Bilck nach China: Ein Land, das sich mit derart rasender Geschwindigkeit verändert, dass man kaum folgen kann. Die Moderne, so scheint es, hat mindestens die Großstädte fest im Griff. Dass die Moralentwicklung der ökonomischen indes hinterher hinkt, verdeutlicht eine kleine niederländische Produktion. In ihrem Dokumentarfilm “Inside The Chinese Closet” stellt Sophia Luvarà Andy und Cherry vor. Er ist schwul, sie lesbisch. Offiziell dürfte das kein Problem mehr sein, heute wird in China keiner mehr wegen seiner Homosexualität ins Gefängnis oder in die Psychiatrie gesteckt. Dennoch ist jede gleichgeschlechtliche Liebe eine gehörige Herausforderung. Denn der Dialog zwischen den kosmopolitischen Kindern und ihren im Kommunismus sozialisierten Eltern ist kompliziert. Die Jungen wollen Liebe und Glück, die Eltern sind reine Pragmatiker: Sie brauchen jemanden, der sich im Alter um sie kümmert. Und sie wollen zumindest nach außen den Eindruck erwecken, dass mit ihrem Kind alles “normal” ist. Also werden Scheinehen geschlossen und in Kliniken abgelegte Babys gekauft. Mädchen sind billiger, die will ohnehin kaum jemand. Sophia Luvarà erzählt mit einem überraschenden Sinn für Humor davon, wie Andy und Cherry nach einem Weg suchen, auf dem sie selbst glaubwürdig bleiben, ohne die Erwartungen der Eltern zu enttäuschen.

Cherry, zwischen ihren Eltern
Jede Kultur steht vor spezifischen Herausforderungen. In der westlichen Welt heißen die: Wie verwirkliche ich mich selbst? Und was fang ich überhaupt an mit der Idee von Familie? Abgründe und Fallstricke zeigt das Kino, von der Komödie bis zum Thriller.Abby Abbasi spielt in dem dänischen Film “Shelly” mit der Horroridee, dass das im Bauch wachsende Baby ein Monster ist, das seine Mutter auffrisst. Ein böser Film, zumal im Körper von Elena das Kind einer anderen heranwächst. Die Brasilianerin Anna Muylaert mag es geerdeter. Sie erzählt in “Meso ha uma” (Don’t call me son) von Pierre, der mit 17 erfährt, dass seine vermeintliche Mutter ihn als Baby geklaut hat. Eine gekonnte Reflektion über das Verhältnis von biologischer und tatsächlicher Mutterschaft.
Bitte ein Kind!
Und dann gab es noch einen Film, der einfach nur Spaß gemacht hat – “Maggie’s Plan” von Rebecca Miller, prominent besetzt mit Ethan Hawke, Julianne Moore und Getra Gerwig. Ein Film wie von Woody Allen, voller Situationskomik, mit wunderbaren Dialogen, einem tollen Soundtrack und einer Geschichte aus dem New Yorker Hier und Jetzt. Maggie will ein Kind, aber keinen Mann. Denn mit engeren Beziehungen hat sie nur schlechte Erfahrungen gemacht. Also sucht sie sich einen Samenspender mit guten Genen, startet die Befruchtung, verliebt sich plötzlich doch, heiratet, bekommt ein Kind. Womit der Film noch längst nicht zu Ende ist, sondern das egomanisch-chaotische Streben nach kontrolliertem Patchwork-Glück erst so richtig Fahrt aufnimmt. Die Moral von dieser Geschichte? Wohlgeordnete Entwürfe sind was für die Schublade, das Leben hat seine eigenen Regeln.